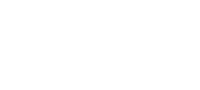Dominique-Vivant Denon in Deutschland 1806-1807
Michelle Welsing
<1>
Dominique-Vivant Denon wurde am 4. Januar 1747 in Givry in eine Familie, die dem untersten Adelsstand angehörte, hineingeboren. Während seines Jurastudiums merkte er schnell, dass er sich mehr zur Kunst hingezogen fühlte und begann eine Künstlerausbildung bei Noël Hallé (1711-1781). Im Jahr 1769 erhielt er von Madame Pompadour (1721-1764) die Stelle als Konservator für ein Gemmenkabinett und im gleichen Jahr wurde er zum Kammerherrn des Königs ernannt. Darauf folgte 1771 eine Anstellung als Botschaftssekretär und 1787 wurde er Mitglied der ‚Académie des Beaux-Arts‘. Zu seinen Freunden zählten schon seit frühester Zeit Künstler, Schauspieler und Gelehrte, was ihm bei seinen späteren Kunstraubzügen eine große Hilfe sein sollte. Während eines Venedigaufenthalts lernte er zum Beispiel Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) kennen. 1797 wurde Denon von Josephine Beauharnais (1763-1814) Napoleon vorgestellt, der ihn ein Jahr später wegen seiner künstlerischen Bildung nach Ägypten berief. 1802 wurde er schließlich zum ‚Directeur général du Musée central des Arts‘ ernannt.
<2>
Im Oktober 1806 kam Denon in die deutschen Gebiete, um sich um die Konfiszierung der dortigen Kunstwerke persönlich zu kümmern. Dies war bereits der vierte Beutezug der Franzosen auf deutschem Boden. Im Unterschied zu anderen Kommissaren, die vorher in deutschen Territorien gewesen waren, war Denon ein Kunstkenner und konfiszierte nur ausgewählte Werke, anstatt planlos zu beschlagnahmen und nach Paris zu schicken. Er studierte die Sammlungen genau und nahm zum Beispiel aus der Gemäldesammlung des Herzogs Anton Ulrich von Braunschweig (1633-1714), welche aus 1.400 Werken bestand, lediglich 271 Bilder mit nach Paris.
<3>
Wie es schon zuvor während der Aufenthalte der anderen Kommissare geschehen war, leisteten die deutschen Konservatoren Widerstand und schickten so viele Kunstwerke wie möglich in andere Städte oder Länder. So stand Denon oft vor unvollständigen Sammlungen. Nichtsdestotrotz war es der Beutezug, der die deutschen Sammlungen die meisten Kunstwerke gekostet hatte. Innerhalb von acht Monaten waren 250 Kisten mit Gemälden, Statuen und dergleichen von Deutschland nach Paris geschickt worden.
<4>
Während all dieser Beschlagnahmungen versuchte Denon diese als legal erscheinen zu lassen, denn der Kunstraub war durch keinen Friedensvertrag legitimiert. Es wurden Beschlagnahmungsprotokolle geschrieben, die von Denon, dem jeweiligen Museumsdirektor und Militärkommandanten unterschrieben wurden. Wenn der jeweilige Museumsdirektor während Denons Besuch nicht anwesend war, wartete Denon bis zu dessen Rückkehr oder verlegte seinen Besuch auf später.
<5>
Diese Situation war nicht die einzige, in welcher Denon und Napoleon sich nicht einig waren. Kunstraub diente erstmals auch der Trophäensammlung – als prominentes Beispiel ist der Abbau der Quadriga vom Brandenburger Tor zu erwähnen. Denon sprach sich gegen dieses Vorhaben aus, doch es war seine Aufgabe für Demontage und Verpackung zu sorgen. Zu dieser Aktion schrieb er an Napoleon: „Nun liege ich vollends mit den Bewohnern von Berlin im Streit. Aber die Frauen, die, was den Takt betrifft zu bewundern sind, haben alle gesagt ‚Dieses Siegesbild hätte ich auch mitgenommen.‘ Die Trophäe ist umso glänzender, als sie keinen wirklichen Wert besitzt.“
<6>
Wofür Denon sich im Gegensatz zu der Trophäensammlung interessierte, waren die bis dahin in Vergessenheit geratenen altdeutschen Meister. Er soll darüber gesagt haben: „Es gibt eine so reine Originalität, eine so berührende Naivität, einen so wahren Ausdruck, eine so reiche Einfalt und so tief gefühlte Frömmigkeit in diesen Arbeiten, dass ich sie der Mehrheit unserer großen Meister unendlich vorziehe, die einer vom anderen nachahmen und übernehmen.“
Anmerkungen
Empfohlene Zitierweise aus dem Beitrag:
Welsing, Michelle, Dominique-Vivant Denon in Deutschland: 1806-1807, in: Gersmann, Gudrun / Grohé, Stefan (Hrsg.), Ferdinand Franz Wallraf (1748–1824) – Eine Spurensuche in Köln, DOI: https://dx.doi.org/10.18716/map/00001, Publikationsumgebung mapublishing (2016), URL: hier Seiten-URL einfügen (zuletzt abgerufen am: Abrufdatum einfügen), ggf. für die stellengenaue Zitation „Abs.“ und Absatz-Nr. einfügen.